Freitag, 25. November 2011
Die Misere von Wikipedia
In sechs Jahren Mitarbeit bei Wikipedia habe ich elf Artikel verfasst. Viele mehr werden es wohl nicht werden. Stellen Sie sich mal folgende Diskussion vor: Zu einem Artikel – nehmen wir mal das Fachgebiet Medizin – läuft eine Diskussion, ob das Stichwort einen eigenen Artikel verdient hat, der dann doch recht kurz wäre, oder ob man das Stichwort in einem anderen Artikel unterbringt, der dass Thema etwas umfassender abhandelt (sog. Relevanzdiskussion). Dann bringt jemand das Argument, auch im Pschyrembel hätte das Stichwort einen eigenen Eintrag, woraufhin jemand anderes fragt: „Wer oder was ist Pschyrembel?“.
Auf diesem Niveau habe ich neulich auch in meinem Fachgebiet diskutiert, und mich, als diese Frage auftauchte, ausgeklinkt. In dem Zusammenhang habe ich die Erfahrung gemacht, das sich immer jemand findet, dem der Artikel gehört und der jeden Satz, sei er noch so falsch oder missverständlich, verteidigt wie eine Glucke ihre Küken.
Ich bin dann der Frage nachgegangen, ob es anderen Autoren auch so geht und bin auf einen Beitrag von Jurist2 gestoßen, dem es nicht gelungen ist, dem Besitzer des Artikels klarzumachen, dass Geldstrafe und Geldbuße nicht das gleiche ist und dessen Korrekturen rückgängig gemacht wurden (nachlesen).
Darin liegt die große Misere von Wikipedia. Autoren vom Fach machen sich rar, weil das Niveau der Diskussion gering ist und sie trotz Fachwissen als Neuling ausgegrenzt werden. Dabei ist Fachwissen das A und O der ganzen Sache. Umfangreiche Stichworte bestehen zum größten Teil aus zusammengegoogelten Textblöcken, diese Artikel werden immer länger, ohne dass die Qualität steigt.
Außer dem dem geringen Niveau der Diskussion ist auch der Tonfall abschreckend. Bei einigen Mitarbeitern ist der aufgestaute Frust deutlich ablesbar. Es bleibt als Fazit: Wikipedia steckt in einer Sackgasse, unter den gegebenen Umständen ist die Mitarbeit für Autoren mit Fachwissen verschwendete Zeit.
Auf diesem Niveau habe ich neulich auch in meinem Fachgebiet diskutiert, und mich, als diese Frage auftauchte, ausgeklinkt. In dem Zusammenhang habe ich die Erfahrung gemacht, das sich immer jemand findet, dem der Artikel gehört und der jeden Satz, sei er noch so falsch oder missverständlich, verteidigt wie eine Glucke ihre Küken.
Ich bin dann der Frage nachgegangen, ob es anderen Autoren auch so geht und bin auf einen Beitrag von Jurist2 gestoßen, dem es nicht gelungen ist, dem Besitzer des Artikels klarzumachen, dass Geldstrafe und Geldbuße nicht das gleiche ist und dessen Korrekturen rückgängig gemacht wurden (nachlesen).
Darin liegt die große Misere von Wikipedia. Autoren vom Fach machen sich rar, weil das Niveau der Diskussion gering ist und sie trotz Fachwissen als Neuling ausgegrenzt werden. Dabei ist Fachwissen das A und O der ganzen Sache. Umfangreiche Stichworte bestehen zum größten Teil aus zusammengegoogelten Textblöcken, diese Artikel werden immer länger, ohne dass die Qualität steigt.
Außer dem dem geringen Niveau der Diskussion ist auch der Tonfall abschreckend. Bei einigen Mitarbeitern ist der aufgestaute Frust deutlich ablesbar. Es bleibt als Fazit: Wikipedia steckt in einer Sackgasse, unter den gegebenen Umständen ist die Mitarbeit für Autoren mit Fachwissen verschwendete Zeit.
am 25. November 11
|
Permalink
|
0 Kommentare
|
kommentieren
Sonntag, 13. November 2011
Von Heimat redet hier keiner
2000 erschien Wäldchestag, das preisgekrönte Erstlingswerk von Andreas Maier. Für mich ein großer Wurf und eines der lesenswertesten deutschen Bücher der letzten 20 Jahre. Diese Einschätzung rührt sicher auch daher, dass ich damals schon sieben Jahre in Hessen lebte und mit dem Begriff Wäldchestag etwas anfangen konnte. Hubert Spiegel in der FAZ zog Parallelen zu Thomas Bernhard (Tonfall), Eckhard Henscheid (Liebe zum Geschwätz) und Arnold Stadler (der mikroskopische Blick aufs Dorf).
Wer das Dorfleben, speziell das hessische, nicht kennt, muss bei der Lektüre eine zusätzliche Hürde nehmen. Dabei gibt es eine lesenswerte soziologische Einführung in das Dorfleben genau jener Wetterau, in der Wäldchestag von Andreas Maier spielt. Ich bin fast sicher, daß Andreas Maier das Buch von Kurt Anker, das ich hier empfehle, gelesen hat. Der Titel Von Heimat redet hier keiner ist programmatisch. Anker schreibt wie Maier über die Heimat – die Wetterau ist Ihre gemeinsame Heimat - ohne den Begriff selbst zu strapazieren. Und sie stellen fest, dass auch die anderen Wetterauer nicht von Heimat reden, weil ihr ganzes Reden (und Handeln) Heimat ist. Kurt Anker - der Name ist Pseudonym, weil der Autor in dem ungenannten Dorf lebt, das er beschreibt - hat das Dorfleben viele Jahre beobachtet und schreibt über die Regeln und Besonderheiten des alltäglichen Lebens. Er erläutert die ungeschriebenen Gesetze, die Zugereiste nicht kennen und nicht erkennen können. Sein besonderer Blick gilt den Außenseitern des Dorfes und der heranwachsenden Jugend – und da schließt sich der Kreis zu Andreas Maier und seinen Helden Schossau und Wiesner.
Buchtipp:
Kurt Anker: Von Heimat redet hier keiner, Marburg, 1987. Vergriffen, aber in gutsortierten Antiquariaten erhältlich
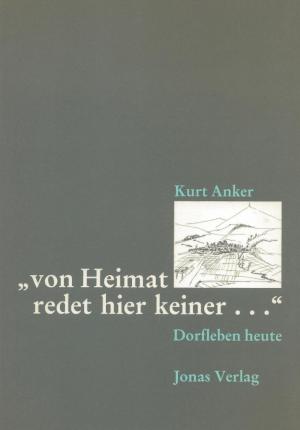
Wer das Dorfleben, speziell das hessische, nicht kennt, muss bei der Lektüre eine zusätzliche Hürde nehmen. Dabei gibt es eine lesenswerte soziologische Einführung in das Dorfleben genau jener Wetterau, in der Wäldchestag von Andreas Maier spielt. Ich bin fast sicher, daß Andreas Maier das Buch von Kurt Anker, das ich hier empfehle, gelesen hat. Der Titel Von Heimat redet hier keiner ist programmatisch. Anker schreibt wie Maier über die Heimat – die Wetterau ist Ihre gemeinsame Heimat - ohne den Begriff selbst zu strapazieren. Und sie stellen fest, dass auch die anderen Wetterauer nicht von Heimat reden, weil ihr ganzes Reden (und Handeln) Heimat ist. Kurt Anker - der Name ist Pseudonym, weil der Autor in dem ungenannten Dorf lebt, das er beschreibt - hat das Dorfleben viele Jahre beobachtet und schreibt über die Regeln und Besonderheiten des alltäglichen Lebens. Er erläutert die ungeschriebenen Gesetze, die Zugereiste nicht kennen und nicht erkennen können. Sein besonderer Blick gilt den Außenseitern des Dorfes und der heranwachsenden Jugend – und da schließt sich der Kreis zu Andreas Maier und seinen Helden Schossau und Wiesner.
Buchtipp:
Kurt Anker: Von Heimat redet hier keiner, Marburg, 1987. Vergriffen, aber in gutsortierten Antiquariaten erhältlich
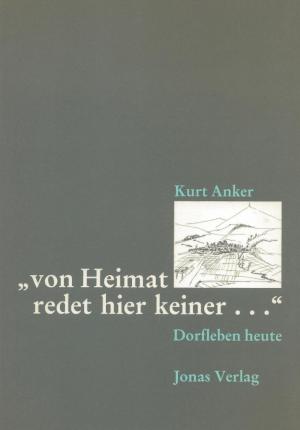
am 13. November 11
|
Permalink
|
0 Kommentare
|
kommentieren
Donnerstag, 10. November 2011
Heiße Zitrone
Es ist wieder Erkältungssaison, und zu meinen bevorzugten Hausmitteln gehört, neben heißer Milch mit Honig, heiße Zitrone. Während der Honig die gereizten Schleimhäute beruhigt, soll die Zitrone mit Vitamin C helfen. Die alte Frage: Überlebt Vitamin C im heißen Wasser? Die Antwort ist, nach Einlesen in die Details, gar nicht so schwierig. Vitamin C ist empfindlich, nicht nur gegen Wärme, sondern praktisch gegen alles (Sauerstoff, Licht...). Die Temperatur, bei der Vitamin C vollständig zerstört wird, liegt aber jenseits der Temperatur von heißem Wasser. Deshalb folgender Tipp: Den Zitronensaft erst ins Wasser schütten, wenn dieses schon Trinktemparatur hat - und dann nicht lange warten, sondern zügig trinken. So überlebt die maximale Menge Vitamin C. Zur Ergänzung rohe Paprika knabbern. Leicht zu merken: Gelbe Paprika hat am meisten Vitamin C.
Ein Tipp für den Zitronenkauf: Was bei Pfirsichen im Supermarkt ein Dauerproblem ist - unreife Früchte - habe ich neulich auch bei Zitronen erlebt (real). Unreife Zitronen fast ohne Saft. Da schöne reife Zitronen schnell schimmeln, mache ich folgendes: Wenn in der großen Kiste schon ein verschimmeltes Exemplar liegt, greife ich zu und nehme ein paar von den anderen. Diese lasse ich liegen:

Ein Tipp für den Zitronenkauf: Was bei Pfirsichen im Supermarkt ein Dauerproblem ist - unreife Früchte - habe ich neulich auch bei Zitronen erlebt (real). Unreife Zitronen fast ohne Saft. Da schöne reife Zitronen schnell schimmeln, mache ich folgendes: Wenn in der großen Kiste schon ein verschimmeltes Exemplar liegt, greife ich zu und nehme ein paar von den anderen. Diese lasse ich liegen:

am 10. November 11
|
Permalink
|
0 Kommentare
|
kommentieren
Sonntag, 6. November 2011
Das wirkliche Leben
Wo finden Sie das wirkliche Leben?
Wilhelm Genazino: Wenn ich in Hagen oder Osnabrück aus dem ICE steige.
SZ-Magazin 44/2011
Wilhelm Genazino: Wenn ich in Hagen oder Osnabrück aus dem ICE steige.
SZ-Magazin 44/2011
am 06. November 11
|
Permalink
|
0 Kommentare
|
kommentieren
Suche
Beiträge
Themen
Blogs
Fachinformation
Navigation
Archiv
- Dezember 2025MoDiMiDoFrSaSo12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Test